Psychische Gesundheit und Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
Wie das BEM auch bei psychischen Beeinträchtigungen gelingt
Psychische Gesundheit umfasst emotionales, soziales und berufliches Wohlbefinden sowie die Fähigkeit, Belastungen zu bewältigen (BAuA o. D.). Belastungen, die über einen längeren Zeitraum bestehen, wirken sich negativ auf das Wohlbefinden aus. Daraus können psychische Erkrankungen entstehen. Da diese mittlerweile die zweithäufigste Ursache für Krankschreibungen sind und zu den längsten Arbeitsunfähigkeitszeiten führen, wird Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) als Unterstützung im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) immer wichtiger.

Durch das seit 2004 gesetzlich verankerte BEM (§ 167 Abs. 2 SGB IX) sollen die Arbeitsfähigkeit wiederhergestellt, erhalten, gefördert und der Arbeitsplatz gesichert werden. Ob eine Einladung zum BEM angenommen wird, kann wesentlich von der Gestaltung abhängen, die weitgehend in der Verantwortung der Arbeitgebenden liegt. Aus Erfahrungen und Bedarfen lassen sich Gelingensfaktoren für ein wirksames BEM ableiten, die bei psychischer Beeinträchtigung wichtig sind. Um die psychische Gesundheit gut unterstützen zu können, sind personelle, organisationale, materielle und finanzielle Strukturen zu stärken (vgl. z. B. Reuter & Moreno Superlano 2024, Reuter & Prümper 2015). Dazu gehören eine ausreichende personelle Ausstattung, die Qualifikation der Beteiligten, eindeutige Informations- und Kommunikationswege, eine gute Zusammenarbeit, eine geeignete Infrastruktur und neben einem eigenen Budget für das BEM auch ein systematisches Vorgehen zur Finanzierung gezielter Maßnahmen. Zudem ist das BEM immer auch als Teil eines umfassenden BGM mit dem Arbeitsschutz und der Betrieblichen Gesundheitsförderung zu verknüpfen (Giesert 2012).
Professioneller Prozess

Ein professioneller BEM-Prozess besteht aus aufeinander aufbauenden Schritten. Wird ohne gründliche Analyse der Ausgangssituation direkt mit der Maßnahmenplanung begonnen, werden die Ziele des BEM oftmals nicht erreicht, da notwendige Anpassungen der Arbeitsbedingungen fehlen. Daher ist eine ganzheitliche Analyse vor der Maßnahmenplanung entscheidend (Reuter et al. 2024). Geeignete Instrumente sind das "Haus der Arbeitsfähigkeit" (Ilmarinen/Tempel 2002) und Belastungsanalysen wie der Kurzfragebogen zur Arbeitsanalyse (Prümper et al. 1995). Rahmenkonzepte wie das Arbeitsfähigkeitscoaching® (Giesert et al. 2013 und Reuter et al. 2024) stützen den systematischen BEM-Prozess.
65 Prozent der Befragten einer Untersuchung von Sander et al. (2023) würden sich für eine psychische Erkrankung schämen und 62 Prozent mit Vorgesetzten und Kolleginnen und Kollegen nicht darüber sprechen. Das Stigma wird auch die "zweite Krankheit" genannt (Finzen 1996) und behindert gezielte Unterstützung. Betriebe können wesentlich zur Destigmatisierung beitragen und sollten vor allem auf gezielte Qualifizierungsmaßnahmen und Kontaktinterventionen setzen (für mögliche Interventionen s. Schläger 2024).
Vor allem BEM-Beauftragte, Führungskräfte, betriebliche Interessenvertretungen, Betriebsmedizinerinnen und -mediziner sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit profitieren von spezifischen Qualifizierungen für das BEM, um dieses entsprechend den Zielen gemeinsam durchführen zu können (Giesert & Kremser 2024). Eine gute innerbetriebliche Zusammenarbeit ist entscheidend für den Erfolg von BEMMaßnahmen. Für das Fallmanagement eignen sich die anerkannten Qualifizierungen Arbeitsfähigkeitscoaching® und Certified Disability Management Professional (CDMP).
Prävention
Vorbeugende Maßnahmen wie Programme zur Förderung der Gesundheit tragen dazu bei, dass weniger BEM-Fälle entstehen. Auch sind sie kostengünstiger als individuelle BEM-Verfahren (Richter 2002, S. 47). Führungskräfte spielen dabei eine zentrale Rolle und brauchen, um präventiv handeln zu können, Informationen und Handlungssicherheit im Umgang mit psychisch belasteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Struhs-Wehr 2017).
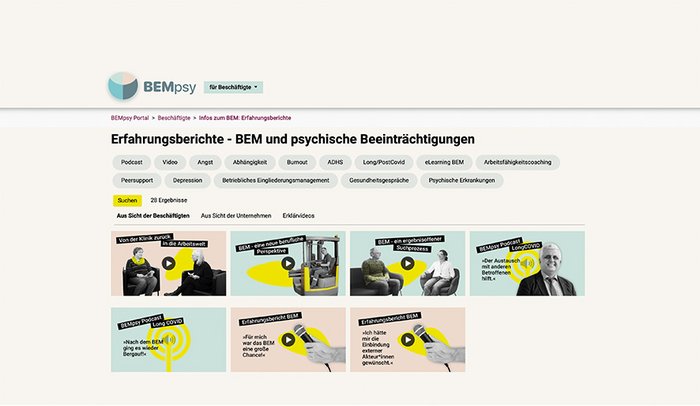
BEMpsy unterstützt beim BEM
Die kostenfreie, digitale Informationsplattform BEMpsy (www.bempsy.de) stellt Beschäftigten und Unternehmen umfangreiche Unterstützungsmaterialien zum BEM bereit. Sie bietet:
- Informationen und Empfehlungen
- Erfahrungsberichte
- Materialien zum Download
BEMpsy erleichtert den Zugang zu fundierten Informationen und stärkt die professionelle Umsetzung des BEM, insbesondere bei psychischen Erkrankungen.
Fazit
Das Bewusstsein für psychische Gesundheit als ein zentrals Thema im BEM wächst. Erfolgskriterien liegen in gut strukturierten Prozessen, Destigmatisierung, qualifizierten Beteiligten und präventiven Maßnahmen. Mit Plattformen wie BEMpsy stehen qualitätsgesicherte, kostenfreie Angebote bereit, die den BEM-Prozess wirksam unterstützen.
Literatur
BAuA (o. D.): Return to Work nach psychischer Krise – Wiedereingliederung nach psychischer Krise – Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Online verfügbar: https://www.baua.de/DE/Themen/Praevention/Betriebliche-Praeventionsarbeit/Psychische-Krise/Psychische-Krise.
Giesert, M. (2012): Arbeitsfähigkeit und Gesundheit erhalten: Fördermöglichkeiten im ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsmanagement. In: AiB – Arbeitsrecht im Betrieb, 5, S. 336–340.
Giesert, M. et al. (2013): Neue Wege im Betrieblichen Eingliederungsmanagement – Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit wiederherstellen, erhalten und fördern. Ein Handlungsleitfaden für Unternehmen, betriebliche Interessensvertretungen und Beschäftigte. DGB Bildungswerk BUND.
Ilmarinen, J.;Tempel, J. (2002): Arbeitsfähigkeit 2010. Was können wir tun, damit Sie gesund bleiben? VSA: Verlag.
Prümper, J. et al. (1995): KFZA – Kurzfragebogen zur Arbeitsanalyse. In: Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie, 39, S. 125–132.
Reuter, T. et al. (2024): BEM bei psychischer Beeinträchtigung – Das Rahmenkonzept Arbeitsfähigkeitscoaching. In: Giesert, M.; Reuter, T.; Liebrich, A.(Hg.), Psychische Gesundheit im Arbeitsleben: Professionelle und digitale Unterstützung im Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM). VSA: Verlag, S. 35-45.
Reuter, T.; Moreno Superlano, K. (2024): Evaluation im BEM. In: Giesert, M.; Reuter, T.; Liebrich, A. (Hg.): Psychische Gesundheit im Arbeitsleben: Professionelle und digitale Unterstützung im Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM). VSA: Verlag, S. 269–279.
Reuter T.; Stadler, D. (2015): Das BEM-Verfahren und notwendige Strukturen im Betrieblichen Eingliederungsmanagement. In: Prümper, J.; Reuter, T.; Sporbert, A. (Hg.): Betriebliches Eingliederungsmanagement erfolgreich umsetzen. Ergebnisse aus einem transnationalen Projekt. HTW Berlin, S. 49–53.
Richter, P. (2002): Belastung und Belastungsbewältigung in der modernen Arbeitswelt. Flexibilisierung und Intensivierung der Arbeit – Konsequenzen für einen Wandel der psychischen Belastungen. In: Schumacher, J.; Reschke, K.; Schröder, H. (Hg.): Mensch unter Belastung. Erkenntnisfortschritte und Anwendungsperspektiven der Stressforschung. Frankfurt: Verlag für Akademische Schriften, S. 44–65.
Sander, C. et al. (2023): Mental health shame and presenteeism: Results from a German online survey. In: Psychiatry Research Communications, 3(1), 10010; doi.org/10.1016/j. psycom.2023.100102.
Finzen, A. (1996): „Der Verwaltungsrat ist schizophren“. Krankheit und das Stigma. Psychiatrie-Verlag.
Schläger, J. (2024): Destigmatisierung als Voraussetzung für ein gelingendes BEM im Kontext psychischer Beeinträchtigung. In: Giesert, M.; Reuter, T.; Liebrich, A. (Hg.):Psychische Gesundheit im Arbeitsleben: Professionelle und digitale Unterstützung im Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM). VSA: Verlag, S. 250–259.
Struhs-Wehr, K. (2017): Umgang mit belasteten Mitarbeitern. In: Betriebliches Gesundheitsmanagement und Führung. Springer, Wiesbaden, S. 147–174. doi.org/10.1007/978-3-658-14266-7_5.
